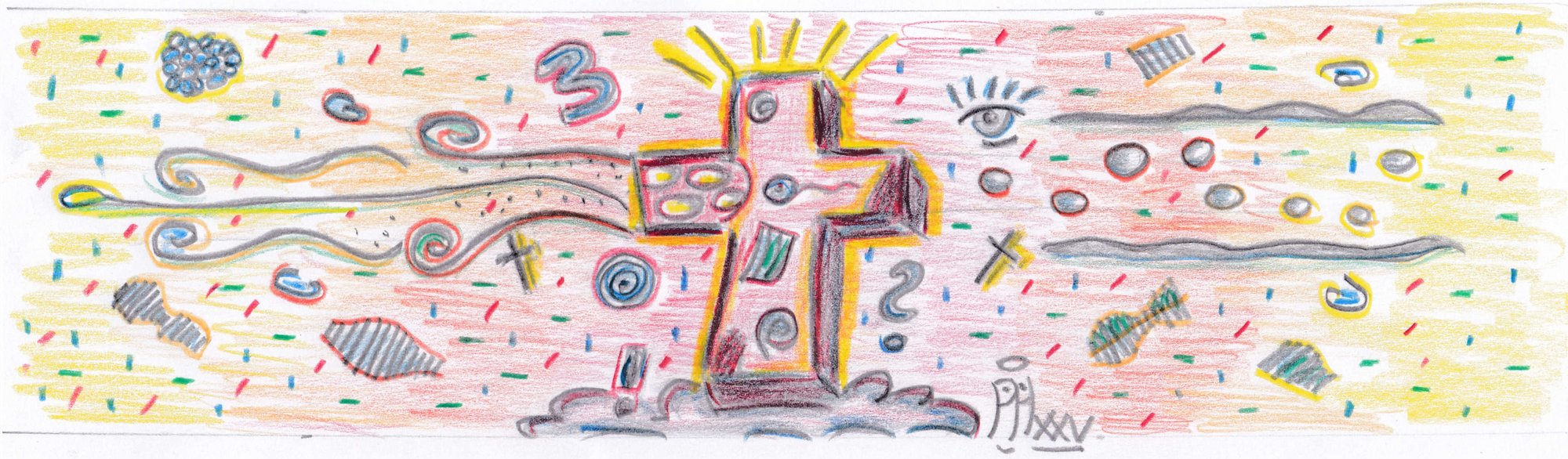Und was kostet das?
Kirchenmitglieder mit lohnsteuerpflichtigem Einkommen tragen durch ihre Kirchensteuer die Kosten der kirchlichen Arbeit mit. Die Kirchensteuer gibt es in Deutschland seit rund einhundert Jahren. Der entsprechende Artikel in der Weimarer Verfassung von 1919 wurde ins Grundgesetz der Bundesrepublik übernommen: Die großen Religionsgemeinschaften können als Körperschaften des öffentlichen Rechts unter Mithilfe des Staates Geld von ihren Mitgliedern einziehen. Die Höhe der Kirchensteuer ist an die Lohn- und Einkommensteuer gekoppelt.
Dienste der Kirche finanzieren
Die Kirchensteuer finanziert die Dienste der Kirche. Im Prinzip entrichten alle Kirchenmitglieder Kirchensteuer. Faktisch aber zahlt nur rund ein Drittel der Mitglieder Kirchensteuer. Wer keine Lohn- oder Einkommensteuer entrichten muss, zahlt auch keine Kirchensteuer. Rentner zahlen höchstens für den Ertragsanteil der Rente Kirchensteuer, welcher der Einkommensteuer unterliegt. Der Kirchensteuersatz beträgt in Sachsen-Anhalt neun Prozent der Lohn- und Einkommensteuer.
Wer aus der Kirche austritt, muss durch den Wegfall der Kirchensteuer mehr Lohn- oder Einkommensteuer zahlen. Bei zusammenveranlagten Ehepaaren, bei denen beide Ehepartner ein zu versteuerndes Einkommen haben und bei denen der eine Ehepartner der evangelischen, der andere aber der katholischen Kirche oder einer anderen steuerberechtigten Glaubensgemeinschaft angehört, wird die volle Kirchensteuer berechnet und auf die beiden Kirchen je zur Hälfte aufgeteilt.
Ist ein einkommensteuerpflichtiger Ehepartner konfessionslos, so wird die Kirchensteuer des zur evangelischen Kirche gehörenden einkommensteuerpflichtigen Ehepartners nach der in seiner Person gegebenen Bemessungsgrundlage entrichtet. In diesen Zusammenhang gehört das "besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe". Es wird berechnet, wenn nur ein Ehepartner einer steuerberechtigten Kirche angehört und über kein oder nur über ein geringes Einkommen verfügt. Es wird nach einem gestaffelten Satz vom gemeinsam zu versteuernden Einkommen erhoben und ist deutlich niedriger als die Kirchensteuer.
Die Kirchen nutzen wegen des geringeren Verwaltungsaufwands die Möglichkeit, die Kirchensteuer von den Finanzämtern einziehen zu lassen. Für diese Dienstleistung zahlen die Kirchen dem Staat eine Vergütung.
Der größte Anteil der Kirchensteuer fließt in die Bereiche Seelsorge, Verkündigung und allgemeine Gemeindearbeit. Dazu gehören die Personalkosten, die Zuweisungen an die Kirchengemeinden, die übergemeindliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen. Weitere Aufgabenfelder sind die diakonische Arbeit (soziale Einrichtungen, Sozialstationen, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser) und die evangelischen Kindertagesstätten. Zu den Kernaufgaben der Kirche gehört auch die Pflege und Unterhaltung der zahlreichen größtenteils denkmalgeschützten Kirchengebäude.